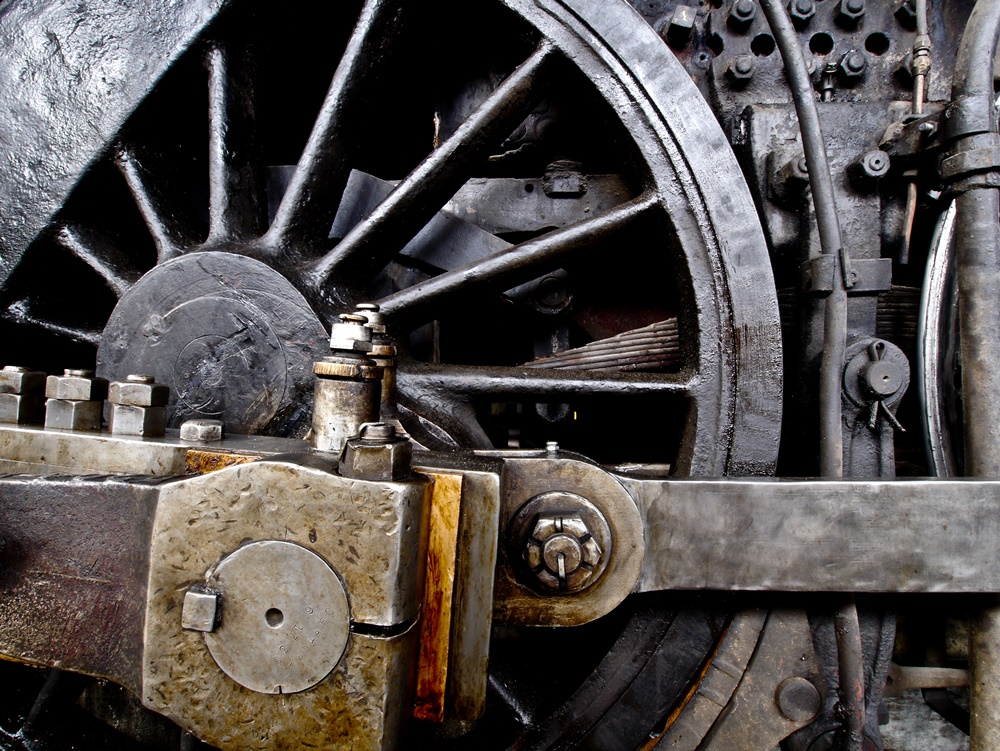„Heute können Sie schreiben, was Sie wollen – Sie können mich nicht mehr schädigen.“ Der Wiener Kabarettist Gerhard Bronner über den „G’schupften Ferdl“, die SPÖ, gewonnene wie verlorene Prozesse – und warum Österreich doch nicht untergeht. Ein Gespräch.
Mit dem „G’schupften Ferdl“ schrieb er Wiener Kleinkunstgeschichte: Gerhard Bronner, Kabarettist und Komponist Jahrgang 1922, geboren in Wien-Favoriten. 1938 emigrierte er nach Palästina, zehn Jahre später kehrte er nach Wien zurück und wurde hier zu einer zentralen Figur des Kabaretts der Fünfzigerjahre. Gemeinsam mit Helmut Qualtinger, Peter Wehle und Carl Merz zeichnete er für Erfolgsprogramme wie „Brettl vorm Kopf“, „Glasl vorm Aug“ und „Hackl vorm Kreuz“ verantwortlich. Es folgten zahlreiche Arbeiten für Hörfunk und Fernsehen, darunter die satirischen Sendungen „Guglhupf“ und „Zeitventil“. 1987 wurde Bronner wegen Steuerhinterziehung von insgesamt 5,5 Millionen Schilling zu einer Geldstrafe von einer Million Schilling verurteilt. Er lebt in Florida.
Gerhard Bronner, wie lebt es sich als Wiener Kabarettdenkmal?
Seltsam. Schon allein deshalb, weil ich nie die Absicht gehabt habe, so etwas zu werden.
Sie wollten immer Musiker sein. Wieso dann überhaupt der Weg zum Kabarett?
Weil es die einzige Form von Theater war, die ich mir selbst finanzieren konnte. Alles andere hätte subventioniert werden müssen, und das war damals, in der Nachkriegszeit, weder denk- noch durchführbar. Keine der in Wien vorhandenen Bühnen wäre bereit gewesen, mich oder meine Freunde für irgendetwas zu engagieren; das, was wir gemacht haben, war so außerhalb der Norm, dass wir unseren eigenen Spielraum suchen mussten.
Was war denn außerhalb der Norm?
Als ich im 52er-Jahr den „G’schupften Ferdl“ geschrieben habe, da haben die Verleger gesagt: Das ist kein richtiger Boogie, das ist kein richtiges Wienerlied, mit dem sitzen Sie zwischen sämtlichen Stühlen im Gatsch. Was die sich nicht vorstellen konnten: dass das Publikum nicht ständig denselben Quargel hören will, dass es dankbar ist für jede Veränderung, die einigermaßen fundiert ist. Der „G’schupfte Ferdl“ hätte genauso gut in die Binsen gehen können, wenn er drei Jahre davor oder zehn Jahre danach geschrieben worden wäre. Ich habe zufällig den richtigen Zeitpunkt erwischt, wo die Wiener Musikkonsumenten gerade so viel vom Soldatensender der Amerikaner verseucht waren, dass so etwas möglich war. Die Idee, diese Musik mit wienerischem Slang auszutextieren, das war etwas so Ungewöhnliches, das war eine Revolution – auch wenn das blöd klingt, wenn man das von seinen Sachen sagt, 43 Jahre nachdem sie entstanden sind.
Jetzt reden Sie seit einiger Zeit von einem Riesenerfolg, auch einem musikalischen Riesenerfolg. Wieso hat sich der nicht fortgesetzt?
Er hat sich ja fortgesetzt.
Aber nur in Richtung Kabarett.
Ich habe später, nachdem ich ziemlich erfolgreich geworden war als Kabarettautor und Komponist, viel im Theater an der Wien gearbeitet. Ich hab‘ da amerikanische Musicals übersetzt. Eines Tages habe ich dem damaligen Direktor gesagt, das war der Rolf Kutschera: Wir sind doch überhaupt nicht verpflichtet, die ganze Zeit den Bestand der Amerikaner für teures Geld hierher zu verpflanzen, wir können doch selber so etwas machen. Pass auf, ich hab‘ ein Stück. Und ich habe es ihm zu lesen gegeben. Da ich Direktoren sehr gut kenne, ich war selber einer, habe ich einen einfachen Trick angewandt: Ich habe nach der sechsten, siebenten Seite zwei Seiten mit Wachs zusammengeklebt; so kann man ganz leicht erkennen, ob einer das gelesen hat oder nicht. Er gibt’s mir zwei, drei Wochen später zurück, sagt: Das ist nix. Ich schau nach: Natürlich hat er’s nicht gelesen.
Ich glaube, Wien ist Kulturstadt und Musikstadt und Theaterstadt genug, dass sie Anrecht hätte auf Produktionen, die für das lebende Wiener Publikum heute geschrieben werden. Das war, denke ich, das Geheimnis unseres großen Erfolges im Kabarett; das Publikum, das zu uns kam, hatte immer das Gefühl: Das ist für mich geschrieben. Wenn man einmal das Gefühl hat zu wissen, was das Publikum will, dann muss man ihm das auch geben, und zwar in einer bestimmten Dosierung, immer den Kompromiss erstellen zwischen dem, was ich eigentlich sagen will, und dem, was das Publikum gerade noch in der Lage ist aufzunehmen. Das ist eine Gratwanderung. Ich gebe zu, ich bin einige Male abgestürzt.
Auf welche Seite?
Meistens habe ich die Aufnahmebereitschaft des Publikums überschätzt. Ich habe zum Beispiel mit meinem mittlerweile verstorbenen Freund Federmann ein sehr kabarettistisches, sehr böses und meiner Ansicht nach sehr gutes Musical geschrieben, das hieß „Compañero, olé“. Da ging’s um die Affäre Olah. Das war wirklich recherchiert bis ins kleinste Detail. Die Leute, die es verstanden haben, waren hingerissen und begeistert – aber viele haben es gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Wir galten als linkes Kabarett. Und plötzlich hatten viele Besucher das Gefühl: Die san ja gar nicht links. Die san ja gegen die SPÖ. Was ein Blödsinn war. Wir haben versucht zu zeigen, welche Fehler die SPÖ gemacht hat.
Retrospektiv gesehen glaube ich, dass wir etwas sehr Wichtiges getan haben. An dem damaligen Ausschluss Olahs ist die SPÖ noch nicht zerbrochen, aber es haben damals Stimmen gefehlt. Die Folge war, dass die ÖVP die absolute Mehrheit bekam. Es kam die Regierung Klaus. Es sind Folgen aufgetreten, von denen sich die SPÖ bis zum heutigen Tag nicht erholt hat.
Aber die SPÖ hatte doch erst in den Siebzigerjahren ihre Blüte.
Ja, und jetzt sagen Sie mir noch schnell, wer eigentlich die Hausmacht von Kreisky war. Kreisky hat die SPÖ nicht als gestandene, alte Arbeiterpartei geführt. Die Partei hat sich unter Kreisky sehr verändert. Nicht zufällig hat der alte Pittermann, damals schon blind und sehr verbittert, gesagt: „I waß, du bist ein Freund vom Kreisky, aber ich kann dir jetzt schon mitteilen, das Ende der Ära Kreisky wird ein fürchterliches sein.“ Er hat leider recht gehabt. Denn es war auf einmal eine Führungsgarnitur ohne Partei da.
Die österreichische Innenpolitik scheint Ihnen auch in Florida nicht so egal zu sein, wie Sie manchmal behaupten.
Dazu habe ich das Land zu gern. Mit allen Fehlern und mit allen Katastrophen, die sich in regelmäßige Abständen anbahnen. Ich bin ja schließlich hier geboren. Wenn ich in Amerika lebe, werde ich immer wieder an den uralten Witz erinnert von dem Schiff, das untergeht, alle Leute rennen panisch herum, irgendwo in der Ecke sitzt ein alter Jude und legt eine Patience, kommt einer vorbei, sagt: „Sind Sie meschugge, legen da eine Patience – das Schiff geht doch unter.“ Darauf der Jude: „Ist es mein Schiff?“ Das ist meine Situation in Amerika. Wenn es untergeht, dann gehe ich auch unter – aber ich rede mir ein, es geht mich nix an. Wenn dagegen Österreich untergeht, wenn es hier rabiat schlechter wird, sitze ich zwar nicht auf dem Schiff, aber es ist eigentlich meines.
Geht Österreich unter?
Austria erit in orbe ultima, heißt es so schön. Das Land wird nicht untergehen, aber wenn Sie sich überlegen, welche Säulen in Österreich jahrzehntelang getragen haben und im Lauf der letzten paar Jahre zerbrochen sind oder so morsch geworden sind, dass sie nichts mehr tragen können . . . Jetzt denke ich nicht so sehr an den „Konsum“, der auch einmal eine Säule war. Ich kann genauso gut an die katholische Kirche denken, die ein Schatten dessen ist, was sie einmal war. Denken Sie an die Gewerkschaft, die Arbeiterkammer, den Wirtschaftsbund, die Industriellenvereinigung: Das ist ja alles nix mehr. Die einzige tragende Säule, die noch intakt ist, ist die „Kronen Zeitung“ – und das ist eine Katastrophe.
Titel: Gerhard Bronner sieht schwarz.
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie gern ich anders sehen möchte? Es ist doch kein Vergnügen, ein Pessimist zu sein.
Sie haben ein Buch geschrieben über die „Goldene Zeit des Wiener Cabarets“. Wie golden war diese Zeit wirklich?
Der Titel ist nicht von mir. Wenn uns damals einer gesagt hätte, dass das einmal als goldene Zeit apostrophiert wird, hätte man ihn auf seinen Geisteszustand untersucht. Mehr als das: Besonders nach den Verrissen, die wir damals eingesteckt haben, hätten wir es nicht für möglich gehalten, dass Nummern von damals heute noch gespielt werden, heute noch auf Schallplatte gekauft werden. Ich glaube, es lag auch daran, dass es ein gutes Team war, Leute, die sich gegenseitig gestützt und ergänzt haben.
Einer, der die Zeit erheblich herber schildert, ist Georg Kreisler. Er meint: „Das Team war kein Team, und das Kabarett war kein Kabarett.“
Über Kreisler kann man nicht sehr viel reden. Kreisler ist kein Gesprächsthema für mich.
Sind Sie ein Streithansl?
Eigentlich nicht, obwohl ich unter normalen Umständen keiner Diskussion aus dem Weg gehe.
Aber Sie waren in eine Reihe von Prozessen verwickelt.
Wenn ich zum Beispiel des Plagiats beschuldigt werde, muss ich klagen.
Sind Sie nie um einer Pointe willen zu weit gegangen?
Ich bin wegen einer Kabarettnummer nur ein einziges Mal geklagt worden, aber das gründlich, das war 1965, wegen meiner Attacke gegen den Wiener Welthandelsprofessor Borodajkewycz und seine antisemitischen Äußerungen. Da habe ich es ganz bewusst darauf angelegt, den Menschen zu schädigen. Aber alles, was ich über ihn gesagt und geschrieben habe, konnte nachgewiesen werden.
Ja, und einmal habe ich etwas gemacht, was allerdings keine Klage zur Folge hatte: Als in Deutschland eine Terrorwelle der RAF losbrach, da habe ich in der Sendung „Schlager für Fortgeschrittene“ eine ganze Stunde lang nur Lieder gespielt, die zum Terror aufrufen. Unter anderen auch etliche Nummern vom Kreisler. Das nimmt er mir bis heute übel. Mit Recht: Ich wollte ihn bloßstellen.
Ansonsten glaube ich nicht, außergewöhnlich viele Prozesse geführt zu haben. Leute, die mich schädigen wollten oder geschädigt haben, die habe ich hin und wieder geklagt, meistens ergebnislos. Österreichische Richter haben ein Faible dafür, mich zu benachteiligen. Aber ich kann es ihnen nicht verübeln, ich habe den österreichischen Richtern im Lauf der Jahre ziemlich viel Stoff gegeben, mir gegenüber nicht sehr freundlich eingestellt zu sein.
Wie haben Sie Helmut Qualtinger kennengelernt?
Durch Zufall, in einer Sauna. Da hatte ich ihn schon auf der Bühne gesehen. Wir sind ins Reden gekommen und haben beschlossen: Wir sollten miteinander etwas machen. Ich habe damals ganz gute Beziehungen zum Rundfunk gehabt und habe mit ihm, mit dem Michael Kehlmann, dem Carl Merz und der Susi Nicoletti, das war die erste Frau in dem Ensemble, eine regelmäßige Rundfunksendung gemacht. Die hieß „Brettl vorm Kopf“. 1952 haben wir beschlossen: Jetzt machen wir aus den vorhandenen Kabarettnummern, die wir für „Rot-Weiß-Rot“ geschrieben haben, ein Kabarettprogramm in einem Theater. Da hat sich herausgestellt, dass sich die Rundfunknummern kaum eignen für das, was uns vorschwebt. So haben wir ein Programm gebaut, das eigentlich mit dem Rundfunkprogramm „Brettl vorm Kopf“ nicht das Mindeste zu tun hatte, wir haben nur den Namen verwendet. Da war dann der „G’schupfte Ferdl“ drinnen. Überflüssig zu vermerken, dass das Programm, was die Presse betrifft, nur Verrisse hatte.
Woher kommen diese Aversionen gegen die Presse?
Das rührt in erster Linie daher, dass ich jahrzehntelang falsch zitiert worden bin, dass man das, was ich an komplizierten Gedankengängen von mir gegeben habe – manche meiner Gedankengänge sind halt nicht schlagwortartig nachzuvollziehen, verzeihen Sie vielmals -, daß man das simplifiziert, auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner geführt hat, der mit meiner tatsächlichen Aussage nichts mehr zu tun hatte.
Warum reden Sie dann überhaupt mit mir?
Wenn Sie nicht ein Tonband laufen hätten, würde ich es wahrscheinlich nicht tun. Erstens. Zweitens: weil’s mir im Lauf der Jahre wurscht geworden ist. Wenn ich in meiner Zeit als Theaterdirektor ein Interview gegeben habe und falsch zitiert worden bin, konnte sich das sehr geschäftsschädigend auswirken. Heute können Sie schreiben, was Sie wollen – Sie können mich nicht mehr schädigen.
Welches Verhältnis haben Sie zu Geld?
Gar keines.
Trotzdem wird überall gerade Ihre Bedeutung als Ökonom des Wiener Kabaretts der Fünfzigerjahre betont.
Wie glücklich wäre ich gewesen, wenn ein anderer das Theater geleitet hätte. Aber es hat kein anderer gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, hätte ich nicht viele Jahre eine wunderbare Sekretärin gehabt, die eigentlich das Theater für mich geleitet hat. Die hat das gemacht, wofür ich später verrufen war – das Theater ökonomisch geführt. Ich hätte es nicht können. Genauso wenig wie bei der Marietta-Bar oder später bei der Fledermaus. Das haben immer andere Leute gemacht, leider nicht immer ganz ehrlich, leider nicht immer gut. Das war ein Grund, warum ich in meine Steuermisere geschlittert bin.
Was denken Sie über den Begriff Heimat?
Ich habe meine Heimat zum ersten Mal verloren, als ich etwas über 15 Jahre alt war, und bin draufgekommen, dass man eigentlich ganz gut ohne Heimat leben kann.
Wolfgang Freitag, „Die Presse“, „Spectrum“, 2. Dezember 1995