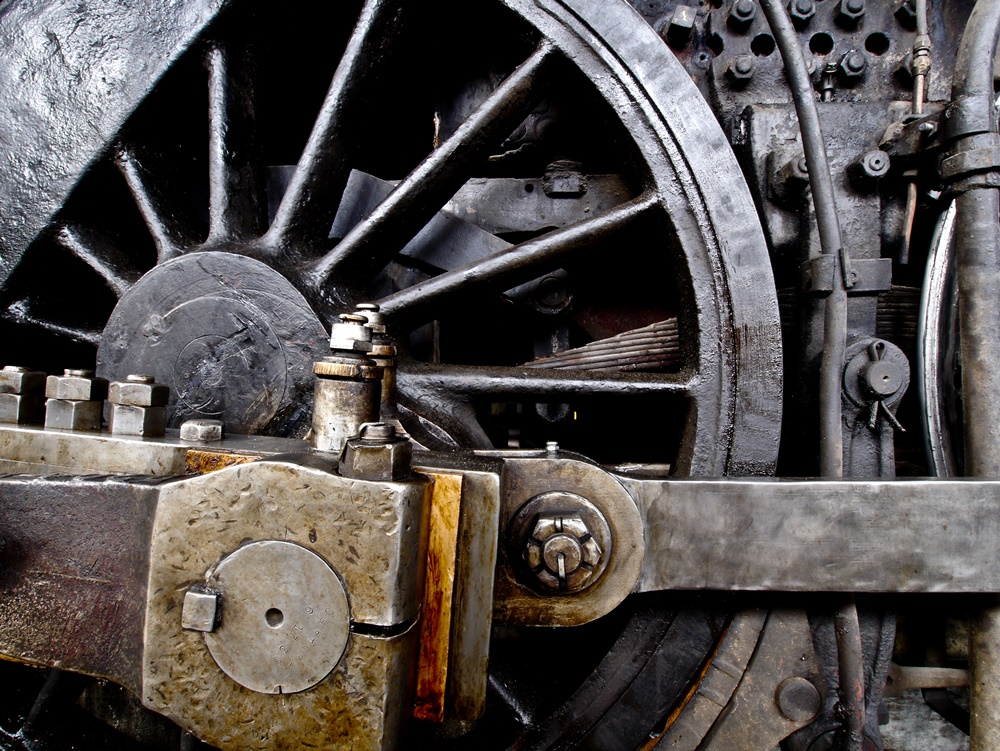Wenn ein Meisterbäcker in Pension geht: Nachruf auf eine Leopoldstädter Institution.
Kein resches Jourgebäck auf dem Samstagfrühstückstisch, kein mild-malziges Berglandbrot, kein Striezel und kein Sandwich: Der August ist für mich seit Jahren ein düsterer Monat. Bäckermäßig. Der August ist der Monat, in dem Mathias Frühbauer samt Familie auf Urlaub geht. Mathias Frühbauer, Bäcker in dritter Generation in der Wiener Darwingasse, dort, wo die Leopoldstadt nicht mehr zentrumsnah, sondern schon Vorstadt ist.
Sicher, es wäre Übertreibung, würde ich behaupten, nur des Frühbauerschen Urlaubs wegen hätte ich selbst ein Gutteil meiner eigenen ferialen Wien-Absenzen in den August verlegt. Und es ist auch nicht wirklich richtig, dass vorzüglich Frühbauers Weiß- und andere Backwaren mich dazu motivierten, meine kürzlich notwendig gewordene Wohnungssuche auf den engsten Kreis rund um die Darwingasse zu beschränken. Aber irgendwie können solche Koinzidenzen doch nicht nur Zufall sein.
Auch diesen August werde ich wieder das erholungsträchtig Weite suchen, auch diesen August werde ich die Backofen-Kunstfertigkeiten des Mathias Frühbauer entbehren müssen. Nur wird sich genau daran nach meiner Wiederkehr nach Wien, im September, im Oktober, im November nichts geändert haben. Wie gewohnt Ende Juli ist in Frühbauers Backstube die alljährliche Brotbackofenkälte des August eingekehrt. Aber diesmal für immer.
„Ein Meisterbäcker geht in Pension!“, steht seit Tagen an der Eingangstür zu lesen. Über allen Knetmaschinen ist Ruh. Und die Markise vor den Auslagenscheiben beschattet nur mehr leere Regale. Nichts Besonderes, keine Frage. Das Bäckerhandwerk und hiesige Backtradition müssten längst auf einer roten Liste der aussterbenden heimischen Kulturleistungen eingetragen sein, wenn es denn eine solche Liste gäbe. Und es müssten sich Proponentenkomitees bilden, und Prominente aller Art müssten sich auf Titelseiten von Boulevardzeitungen so richtig ins Zeug legen für das große, das rotweißrote, das nationale Anliegen. Sagen wir: „Rettet das Kipferl!“
Keine Spur von alledem. Während wir jeden Heustadel, ist er nur alt und also ehrwürdig genug, bewahren und beschützen und, wenn’s not tut, auf Baudenkmal komm raus renovieren, während wir ganze Städte am liebsten in Acryl gössen, auf dass ihnen durch die baulichen Begehrlichkeiten der Moderne nur ja kein architektonisches Leid widerfahre, lassen wir uns widerstandslos mit jenen Semmelsimulationen, jenen Potemkinschen Brotvortäuschungen abspeisen, die uns die industriellen Aufbäcker in Supermärkten und Backkonzernfilialen vorsetzen.
Und es fällt uns schon gar nicht mehr auf, wenn einer von ihnen sogar für werbeslogantauglich hält, was bis vor gar nicht allzu langer Zeit schlichtweg selbstverständlich war: dass er nämlich „selber bäckt“. Ja, bitte, was denn sonst?
Das alles braucht Mathias Frühbauer nicht mehr zu grämen. Er hat wohl schon vor Jahren erkannt, dass seine Vorstellung, seinem Handwerk nachzugehen, längst passé ist. Schließlich konnte es vorkommen, dass ihm der eine oder andere Großabnehmer vorrechnete, um wie viel billiger er dieselbe Leistung bei der Fließbandkonkurrenz bekäme. Und die Qualität? Die ist in solchen Fällen kein Thema mehr. „Schaun Sie, eine Semmel um weniger als einen Schilling, da hat es gar keinen Sinn, mit dem Backen anzufangen“, weiß Mathias Frühbauer. „Da kann ich mit meinem Kleinbetrieb einfach nicht mithalten.“
In zwei Jahren hätte er das 100-Jahr-Jubiläum seiner Bäckerei feiern können. Schwamm drüber. Für Sentimentalitäten aller Art ist in nüchtern-marktwirtschaftlichen Zeiten kein Platz. Da heißt es wachsen oder untergehen. Wer sich schlicht damit bescheiden will, gute Ware zu liefern, der wird nicht lange konkurrenzfähig bleiben. Und im Übrigen, wenn’s drauf ankommt, hat der freie Markt halt auch die Freiheit, sich selbst so ganz allmählich abzuschaffen.
Frühbauer junior jedenfalls hat sich mittlerweile um ein anderes Gewerbe als das des Vaters umgesehen, wenngleich ein wesensmäßig nah verwandtes: Und wer die duftigen Kreationen des gelernten Konditors verkosten durfte, die dann und wann ihren Weg in die Frühbauerschen Bäckerei-Vitrinen fanden, der weiß, dass man sich um seine Zukunft nicht sorgen muss. Doch in Wahrheit kann er gar nicht so gut konditorieren und patissieren, dass er jemals das ersetzen könnte, was mir und vielen Anwohnern über Jahre das Jourgebäck und das Berglandbrot, der Striezel und der Sandwich seines Vaters war: Lebensmittel fürwahr.
Vielleicht werden wir irgendwann von all den Aufbackwaren genug haben, die an der Supermarktkasse, auf der Großbäckerfilialen-Theke noch ganz und wirklich und real „backofenfrisch“ sind – und schon beim Ausgang 100 Jahre alt. Und vielleicht wird dann in der Darwingasse 23 eine Gedenktafel enthüllt: „In diesem Hause wurde im Jahr 1904 ein Stück Wiener Backkultur geboren; und hier starb es, verkannt und geringgeschätzt, im Juli 2002.“ Bis dahin werde ich mir jedenfalls mein Brot und meinen Striezel und meinen Sandwich selber backen. Und dann und wann, kann sein, sogar ein bisserl Jourgebäck.
Wolfgang Freitag, „Die Presse“, „Spectrum“, 3. August 2002